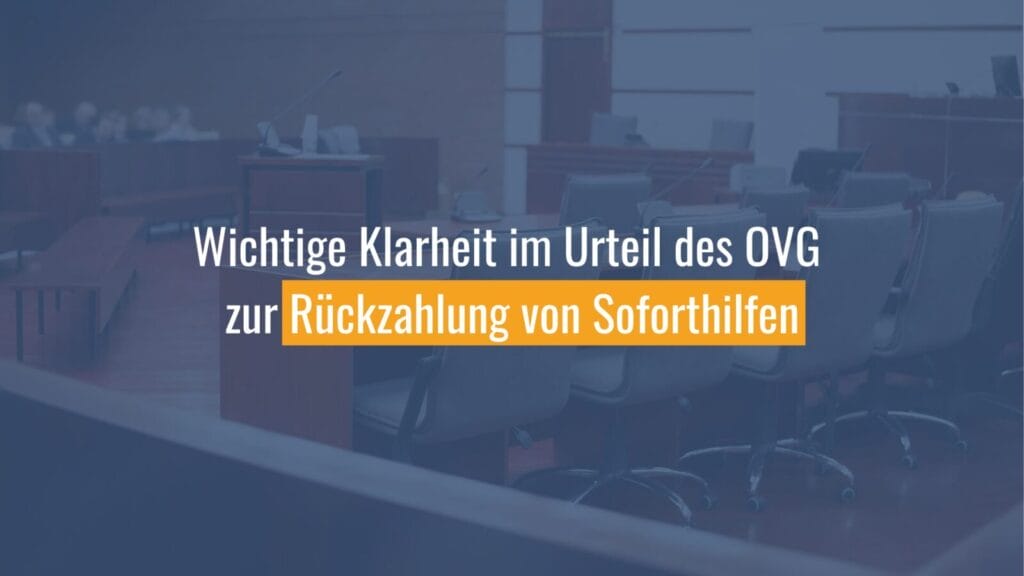Bedeutendes Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen
Die Corona-Pandemie hat viele Selbstständige und Unternehmen hart getroffen, besonders in den ersten Monaten der Krise. In Deutschland wurden deshalb Soforthilfen zur Unterstützung von Unternehmen und Solo-Selbstständigen eingeführt.
Doch auch wenn die Hilfsprogramme mit dem Ziel einer schnellen und unbürokratischen Unterstützung konzipiert waren, führte der Umgang mit den Rückzahlungen in der Praxis zu rechtlichen Auseinandersetzungen. Ein besonders bemerkenswerter Fall wurde im Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen (Az. 4 A 1987/22) vom 17. März 2023 behandelt, bei dem ein Steuerberater auf die Rückforderung der Soforthilfe reagierte. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf den Ausgang des Falls und die Auswirkungen des Urteils auf andere Selbstständige und Unternehmen.
Das Soforthilfeprogramm 2020: Hintergrund und Zielsetzung
Das Soforthilfeprogramm wurde zu Beginn der Corona-Pandemie eingeführt, um Unternehmen bei der Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen zu unterstützen. Der Zuschuss sollte unbürokratisch und schnell zur Verfügung gestellt werden, insbesondere zur Deckung von Betriebskosten wie Mieten, Leasingraten und anderen laufenden Verbindlichkeiten. Für die Antragsteller war es jedoch von entscheidender Bedeutung, glaubhaft zu versichern, dass die Corona-Pandemie eine wirtschaftliche Existenzbedrohung ausgelöst hatte.
Die Hilfen wurden als nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt, allerdings unter der Voraussetzung, dass die Mittel tatsächlich im Einklang mit dem festgelegten Zweck verwendet werden – der Überbrückung von Liquiditätsengpässen aufgrund der Pandemie. Die Höhe der Soforthilfe war dabei gestaffelt und orientierte sich an der Zahl der Beschäftigten im Unternehmen.
Der Zuschuss war als vorläufige Hilfe konzipiert. Die endgültige Höhe der Soforthilfe sollte nach Ablauf des Bewilligungszeitraums festgelegt werden, wenn der tatsächliche Bedarf und die Verwendung der Mittel überprüft wurden.
Der Streitfall: Überkompensation und Rückzahlungsverpflichtung
Im vorliegenden Fall ging es um die Frage, ob ein Steuerberater, der eine Soforthilfe in Höhe von 9.000 Euro erhalten hatte, diese vollständig zurückzahlen musste.
Der Kläger, der während der Pandemie nur begrenzte Einnahmen erzielte, hatte die Soforthilfe beantragt, um akute Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Doch im Rückmeldeverfahren stellte sich heraus, dass der Kläger tatsächlich in allen drei Monaten des Förderzeitraums mehr Einnahmen als Ausgaben gehabt hatte. Nach Abzug eines “fiktiven Unternehmerlohns” von 2.000,00 Euro ergab sich ein Rückzahlungsbetrag in Höhe von 7.000,00 Euro.
Der Streit drehte sich um die Überkompensation, also die Frage, ob der Steuerberater mehr erhalten hatte, als ihm aufgrund seiner tatsächlichen wirtschaftlichen Notlage zustand. Der Kläger machte geltend, bezogen auf den Bewilligungszeitraum habe er Vorträge mit einem Nettohonorarvolumen von 15.950,00 Euro coronabedingt nicht wahrnehmen können. Selbst wenn ein Nettohonorarvolumen von 4.600,00 Euro für kurzfristig aktiv abgehaltene Seminare abgezogen würde, verbliebe noch ein die Soforthilfe übersteigender Umsatzausfall i.H.v. 11.350,00 Euro. Im Betrachtungszeitraum (April bis Juni 2020) habe er Betriebsausgaben von deutlich mehr als 9.000,00 Euro gehabt und somit die Mittel auch benötigt. Die Begrenzung des fiktiven Gehalts auf 2.000,00 Euro für einen Zeitraum von drei Monaten sei bei seiner Antragstellung nicht absehbar gewesen und bei einem in Vollzeit tätigen Akademiker unangemessen.
Der Beklagte berief sich auf die sogenannte Nebenbestimmung II.3. des Bewilligungsbescheids, die eine Rückzahlungspflicht bei Überkompensation vorsah. Das Gericht entschied jedoch, dass die Rückzahlungsverpflichtung nicht so klar und eindeutig formuliert war, dass der Kläger dies bei Antragstellung auch ohne Weiteres erkennen konnte.
Ausgang des Verfahrens
Das Oberverwaltungsgericht entschied, dass der Schlussbescheid rechtswidrig war, da er die bindenden Vorgaben des Bewilligungsbescheids nicht beachtet hatte. Der Kläger habe davon ausgehen dürfen, die Soforthilfe nur dann (teilweise) erstatten zu müssen, wenn sie am Ende des dreimonatigen Bewilligungszeitraums feststellte, dass die Zuwendung höher gewesen sei als der Umsatzausfall (abzüglich eingesparter Kosten), wenn also eine Überkompensation in diesem Sinne vorgelegen habe. Im Zuwendungsbescheid sei auf das Bestehen einer finanziellen Notlage, die Überbrückung von Liquiditätsengpässen bzw. die Kompensation der wirtschaftlichen Engpässe abgestellt worden, ohne diese genau zu umschreiben. Nach seinem Erlass in Kraft getretene Regelwerke oder spätere Informationen, die von jenen bis zum Erlasszeitpunkt abwichen, seien nicht zu berücksichtigen.
Der Schlussbescheid wurde zudem durch ein automatisiertes System erstellt. Der hier erfolgte vollständige Erlass des Schlussbescheids durch automatische Einrichtungen war bereits rechtswidrig, weil er nicht durch Rechtsvorschrift zugelassen und überdies bei der konkreten Ausgestaltung nicht sichergestellt war, dass für den Einzelfall bedeutsame tatsächliche Angaben des Betroffenen Berücksichtigung finden würden.
Aufgrund dieser Mängel wurde der Schlussbescheid aufgehoben und als rechtswidrig erklärt. Der Steuerberater musste die 7.000 Euro somit nicht zurückzahlen.
Bedeutung des Urteils
Vorläufige Bewilligung und Zweckbindung
Das Urteil verdeutlicht, dass die Corona-Soforthilfe vorläufig bewilligt wurde. Dies bedeutet, dass die tatsächliche Verwendung der Mittel und der tatsächliche Bedarf überprüft werden müssen, bevor eine endgültige Entscheidung über die Rückzahlung getroffen wird.
Andere Selbstständige und Unternehmer sollten sich bewusst sein, dass sie möglicherweise Rückzahlungen leisten müssen, wenn sie mehr Hilfe erhalten haben, als sie tatsächlich benötigten.
Bedeutung der Dokumentation der Mittelverwendung
Um spätere Rückforderungen zu vermeiden, sollten Unternehmen die Soforthilfe erhalten haben, ihre Verwendungsnachweise gründlich dokumentieren. Es ist entscheidend, dass die Mittel zweckentsprechend eingesetzt wurden, da das Gericht auch feststellte, dass eine überkompensierte Soforthilfe zurückzuzahlen ist.
Automatisierte Bescheide und ihre Unzulässigkeit
Das Urteil zeigt die rechtlichen Risiken automatisierter Bescheide. Der Bescheid wurde ohne individuelle Prüfung des Falls erlassen, was unzulässig war. Für Steuerberater und andere Selbstständige bedeutet das, dass sie bei Rückforderungen von Soforthilfen darauf achten sollten, dass ihre individuellen Umstände berücksichtigt werden. Ein automatisierter Bescheid ohne menschliche Prüfung könnte Ihre Rechte gefährden.
Auswirkungen auf die Verwaltungspraxis
Das Urteil könnte dazu führen, dass die Behörden in zukünftigen Fällen weniger auf automatisierte Verfahren setzen und stattdessen stärker auf eine individuelle Prüfung achten müssen. Dies könnte zu einer besseren Rechtsstellung für die Antragsteller führen, da ihre spezifische Situation gründlicher berücksichtigt wird.
Schlussfolgerung
Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen zeigt, dass die Verwaltung von Soforthilfen und deren Rückzahlung rechtliche Hürden mit sich bringen kann. Insbesondere die vorläufige Bewilligung und die Zweckbindung der Mittel sind entscheidend, um Missverständnisse und rechtliche Konflikte zu vermeiden.
Unternehmer und Selbstständige sollten sicherstellen, dass sie die Mittel zweckentsprechend einsetzen und ihre Ausgaben ordnungsgemäß dokumentieren, um im Fall einer Rückforderung rechtlich abgesichert zu sein.
Darüber hinaus stellt das Urteil klar, dass automatisierte Bescheide ohne individuelle Prüfung nicht rechtmäßig sind. Zukünftig sollten Behörden Verfahren entwickeln, die automatische Systeme mit einer einzelfallbezogenen Prüfung kombinieren, um die Rechte der Empfänger zu wahren.
Insgesamt zeigt das Urteil, dass eine klare Verwaltungspraxis und transparente Vorgaben notwendig sind, um die Soforthilfe als Instrument zur Krisenbewältigung effektiv und rechtssicher einzusetzen.
Ähnliche Klarstellungen in der Rechtsprechung gab es etwa im Urteil des VG Stuttgart, das bestimmte Rückforderungen als unzulässig einstufte.
Corona-Hilfen im Fokus: Auch in solchen Fällen kann eine anwaltliche Beratung sinnvoll sein, um die Rechte der Soforthilfe-Empfänger zu wahren.
Bei Fragen oder für eine individuelle Beratung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung – zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Hier finden Sie meine Kontaktdaten: rueckforderungsschutz.de/kontakt/