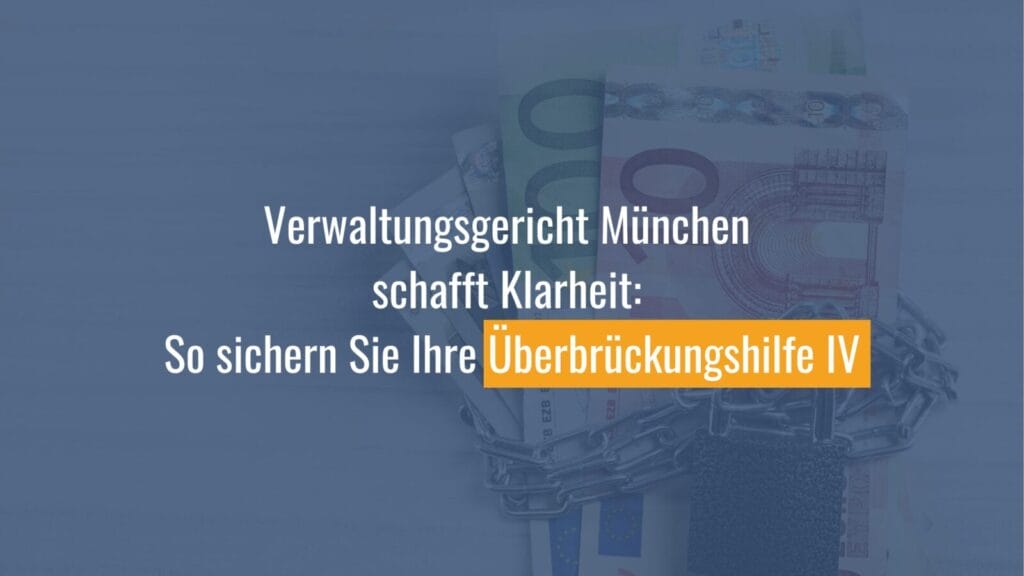Verwaltungsgericht München definiert klare Kriterien für Überbrückungshilfen
Am 24. September 2024 hat das Verwaltungsgericht München eine wichtige Entscheidung im Zusammenhang mit der Überbrückungshilfe IV gefällt (Az. M 31 K 23.3596). Das Urteil betrifft die Frage, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Unternehmen eine solche staatliche Unterstützung rechtmäßig beantragen können. Zugleich geht es um die Rückforderung bereits bewilligter Mittel, wenn die Fördervoraussetzungen nicht nachgewiesen werden können.
Der Fall: Streit um die Überbrückungshilfe IV
Die Klägerin, ein mittelständischer Autohändler, beantragte im April 2022 Überbrückungshilfe IV in Höhe von rund 22.388,93 Euro. Dieser Betrag wurde zunächst bewilligt und am 18. Mai 2022 ausgezahlt. Im Juni 2022 stellte die Klägerin einen Änderungsantrag und forderte eine höhere Förderung in Höhe von 56.757,98 Euro. Der Änderungsantrag wurde mit der Begründung gestellt, dass die Umsatzeinbrüche pandemiebedingt seien und die ursprüngliche Förderung nicht die tatsächlichen Verluste widerspiegele.
Die zuständige Behörde lehnte den Änderungsantrag am 22. Juni 2023 ab, widerrief den ursprünglichen Bewilligungsbescheid und forderte auch noch die bereits ausgezahlten 22.388,93 Euro zurück. Zur Begründung führte die Behörde an, dass die Klägerin keinen coronabedingten Umsatzrückgang nachweisen konnte, wie es die Förderrichtlinien voraussetzen.
Nach erfolglosem Widerspruch reichte die Klägerin Klage ein, die jedoch vom Verwaltungsgericht München abgewiesen wurde.
Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts München
Anforderungen an die Nachweisführung
Ein zentrales Argument der Ablehnung war, dass die Klägerin nicht hinreichend nachweisen konnte, dass ihre Umsatzeinbußen direkt auf staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zurückzuführen waren. Die Klägerin argumentierte, dass die Maskenpflicht und eine generelle Konsumzurückhaltung der Kunden zu den Umsatzrückgängen geführt hätten. Das Gericht sah dies jedoch nicht als ausreichend an. Nach den Förderrichtlinien müssen die wirtschaftlichen Auswirkungen unmittelbar auf staatliche Beschränkungen wie Geschäftsschließungen zurückzuführen sein.
Praktische Konsequenz:
Unternehmen müssen präzise darlegen und belegen, wie genau die Umsatzrückgänge auf spezifische staatliche Maßnahmen zurückzuführen sind. Allgemeine wirtschaftliche Folgen der Pandemie, wie Lieferengpässe oder Änderungen im Kundenverhalten, genügen nicht.
Zeitpunkt der Prüfung
Das Verwaltungsgericht stellte zudem klar, dass bei der Beurteilung der Antragsberechtigung allein der Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung relevant ist. Nachträglich vorgebrachte Argumente und Nachweise, die erst im Gerichtsverfahren eingebracht werden, bleiben unberücksichtigt.
Im konkreten Fall brachte die Klägerin erst während der Gerichtsverhandlung neue Argumente vor, etwa dass ihr Marketingmaßnahmen wie Weihnachtsempfänge aufgrund staatlicher Verbote nicht möglich gewesen seien und es hohe Personalausfälle wegen Corona-Erkrankungen gegeben habe. Das Gericht ließ diese Argumente unberücksichtigt, da sie im Verwaltungsverfahren nicht rechtzeitig vorgetragen worden waren.
Praktische Konsequenz:
Alle relevanten Tatsachen und Belege müssen vollständig und fristgerecht im Verwaltungsverfahren eingereicht werden. Ein späterer Vortrag wird in der Regel nicht berücksichtigt.
Rückforderung von Fördermitteln
Die Rückforderung der bereits ausgezahlten 22.000 Euro wurde ebenfalls vom Verwaltungsgericht bestätigt. Der ursprüngliche Bewilligungsbescheid stand ausdrücklich unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung. Da die Fördervoraussetzungen im Nachhinein nicht nachgewiesen werden konnten, war die Rückforderung rechtmäßig.
Praktische Konsequenz:
Unternehmen sollten sich bewusst sein, dass vorläufig bewilligte Fördermittel zurückgefordert werden können, wenn die Antragsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Ein Vertrauen auf die endgültige Bewilligung besteht erst nach der abschließenden Prüfung durch die Behörde.
Wichtige Erkenntnisse aus dem Urteil
Strenge Anforderungen an die Corona-Bedingtheit
Die Entscheidung unterstreicht, dass nur unmittelbare Auswirkungen staatlicher Maßnahmen als coronabedingt anerkannt werden. Maßnahmen wie die Maskenpflicht, die sich nicht spezifisch gegen einzelne Unternehmen richten, genügen nicht. Unternehmen müssen darlegen, dass ihre Branche unmittelbar betroffen war, etwa durch Schließungsanordnungen oder vergleichbare Eingriffe.
Sorgfaltspflichten der Antragsteller
Das Urteil zeigt auch, wie wichtig es ist, alle relevanten Informationen rechtzeitig und vollständig vorzulegen. Die Antragsteller tragen die Beweislast und müssen aktiv dazu beitragen, die Fördervoraussetzungen zu dokumentieren.
Keine Förderung für „Fernwirkungen“ der Pandemie
Das Gericht stellte klar, dass die Überbrückungshilfe IV nicht dazu dient, allgemeine Probleme oder mittelbare Folgen der Pandemie abzumildern. Auswirkungen wie Lieferkettenprobleme, Konsumzurückhaltung oder Personalausfälle fallen nicht unter den Begriff der „Corona-Bedingtheit“.
Empfehlungen für Unternehmen
Präzise Dokumentation
Stellen Sie sicher, dass Ihre Antragsunterlagen klar belegen, welche staatlichen Maßnahmen Ihre Geschäftstätigkeit direkt beeinflusst haben. Führen Sie konkrete Nachweise, etwa Bescheinigungen über Schließungsanordnungen oder Dokumentationen zu ausgefallenen Veranstaltungen.
Rechtzeitige Einreichung
Achten Sie darauf, alle relevanten Unterlagen im Verwaltungsverfahren fristgerecht einzureichen. Verspätete Beweise oder neue Argumente werden in der Regel nicht berücksichtigt.
Beratung durch Experten
Die Anforderungen an die Antragstellung und Nachweisführung sind komplex. Ziehen Sie rechtzeitig Experten, etwa Rechtsanwälte oder Steuerberater, hinzu, um rechtliche Risiken zu minimieren und Ihre Erfolgschancen zu maximieren.
Fazit: Klare Nachweise und professionelle Beratung sind der Schlüssel
Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts München verdeutlicht die strengen Anforderungen an die Beantragung und Bewilligung von Überbrückungshilfen. Unternehmen sollten sich intensiv mit den Fördervoraussetzungen auseinandersetzen und sicherstellen, dass ihre Anträge gut dokumentiert und begründet sind. Rückforderungen bereits bewilligter Hilfen können erhebliche finanzielle Belastungen nach sich ziehen.
Für Unternehmen, die Unterstützung bei der Beantragung oder Verteidigung von Fördermitteln benötigen, stehe ich Ihnen als Fachanwalt für Steuerrecht zur Seite. Kontaktieren Sie mich für eine umfassende Beratung und Vertretung.
Hier finden Sie meine Kontaktdaten: rueckforderungsschutz.de/kontakt
Hier können Sie das gesamte Urteil nachlesen: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2024-N-30583?hl=true