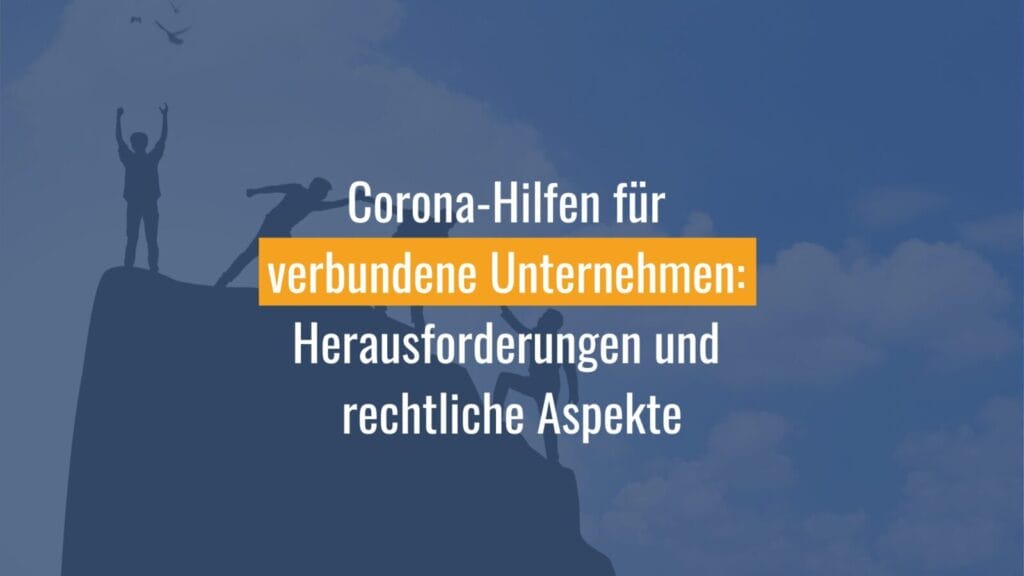Warum verbundene Unternehmen im Fokus stehen
Verbundene Unternehmen spielen eine zentrale Rolle bei der Schlussabrechnung von staatlichen Überbrückungshilfen (ÜBH) im Rahmen der Corona-Pandemie. Häufig kommt es dabei zu Unsicherheiten hinsichtlich der Definition, wer als verbundenes Unternehmen gilt und wie die Anträge sowie die Rückforderungen von Hilfen in solchen Konstellationen rechtlich zu bewerten sind. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf die relevanten Fragestellungen und die aktuellen rechtlichen Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf familiär verbundene Unternehmen.
Was sind verbundene Unternehmen?
Verbundene Unternehmen sind rechtlich selbstständige Firmen, die durch Kapital- oder Kontrollbeziehungen miteinander verbunden sind. Oft handelt es sich um Tochtergesellschaften, die von einer Konzernmutter kontrolliert werden.
Ein praktisches Beispiel: Vermietet die Konzernmutter einer Tochtergesellschaft eine Immobilie, ist es aus Sicht der staatlichen Förderprogramme unsinnig, die Mietzahlungen der Tochter zu fördern, da es sich letztlich nur um einen internen Transfer („linke Tasche, rechte Tasche“) handelt.
Diese konsolidierte Betrachtungsweise spielt eine entscheidende Rolle bei der Vergabe von Corona-Hilfen.
Verbundene Unternehmen bei der Beantragung von Corona-Hilfen
Bei der Beantragung von Corona-Hilfen wurde deutlich, dass verbundene Unternehmen als eine wirtschaftliche Einheit betrachtet werden. Dies bedeutet, dass sie nur einmalig einen Antrag stellen und eine einheitliche Schlussabrechnung einreichen dürfen. Der Hintergrund dieser Regelung liegt darin, mögliche Doppelförderungen zu vermeiden.
Familiäre Verbindungen und ihre rechtlichen Herausforderungen
Eine besonders umstrittene Frage betrifft familiär verbundene Unternehmen. Laut der Interpretation des Bundeswirtschaftsministeriums gelten auch Unternehmen, die familiär verbunden sind, als verbundene Unternehmen.
Dies betrifft beispielsweise Fälle, in denen der Vater ein Kino betreibt und der Sohn ebenfalls ein Kino führt. Nach Auffassung der Behörden sei dies ein verbundenes Unternehmen – obwohl sich diese Auffassung im Europarecht nicht eindeutig belegen lässt.
Der Verweis auf eine Entscheidung der EU-Kommission aus dem Jahr 2006 im Wettbewerbsrecht, die die familiäre Verbundenheit als Indiz für gemeinsames Handeln betrachtet, wurde von vielen Experten als unzureichend kritisiert, da es keine eindeutigen Regelungen oder Präzedenzfälle im Europarecht gibt.
Praktische Beispiele
Ein praktisches Beispiel verdeutlicht die Problematik: Ein Tischlermeister mietet von seiner Ehefrau ein Werkstattgebäude. Nach der Logik der Überbrückungshilfenregelung wird das Ehepaar als verbundene Unternehmer betrachtet, was dazu führt, dass die Mietzahlungen nicht förderfähig sind.
Diese Regelung betrifft auch Fälle, in denen die Vermietung an Verwandte wie Geschwister oder Kinder erfolgt. Diese strenge Auslegung hat zur Folge, dass viele Unternehmen aufgrund familiärer Verbindungen als Einheit betrachtet werden und keinen Anspruch auf Förderung haben könnten.
Verfassungsrechtliche Bedenken
Diese Regelung stößt nicht nur bei den Betroffenen auf Unverständnis, sondern wirft auch verfassungsrechtliche Bedenken auf. Art. 6 des Grundgesetzes schützt Ehe und Familie – die pauschale Annahme, dass familiäre Verbindungen automatisch eine unternehmerische Verbindung darstellen, könnte gegen diesen Schutz verstoßen.
Auch der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz aus Art. 3 GG könnte betroffen sein, da ähnliche Sachverhalte unterschiedlich behandelt werden, ohne dass dies sachlich gerechtfertigt ist.
Rückforderung von Corona-Hilfen für verbundene Unternehmen
Sollte es zu Rückforderungen von Corona-Hilfen kommen, weil die Behörden ein Unternehmen fälschlicherweise als verbundenes Unternehmen einstufen, ist rechtlicher Widerstand ratsam. Insbesondere bei familiären Verbindungen gibt es zahlreiche offene Fragen, die bis zum Bundesverfassungsgericht geklärt werden könnten. Es ist bereits bekannt, dass mehrere Verfahren in diesem Bereich laufen, und es ist zu erwarten, dass hier richtungsweisende Urteile gefällt werden.
Zukunftsperspektiven und Empfehlungen
Die Behandlung von verbundenen Unternehmen im Kontext der Corona-Hilfen wirft komplexe rechtliche Fragen auf, insbesondere wenn familiäre Bindungen ins Spiel kommen.
Es ist zu empfehlen, bei Rückforderungsbescheiden rechtzeitig rechtlichen Rat einzuholen und gegebenenfalls Widerspruch einzulegen. Die Entwicklungen in diesem Bereich werden von vielen Unternehmen und deren rechtlichen Beratern mit Spannung verfolgt.
Der Ausgang der aktuellen Verfahren könnte weitreichende Konsequenzen für die zukünftige Behandlung von verbundenen Unternehmen und staatlichen Hilfsmaßnahmen haben.
Haben Sie Fragen zur Behandlung von verbundenen Unternehmen oder zu möglichen Rückforderungen von Corona-Hilfen? Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre rechtlichen Anliegen zu besprechen und Sie bei eventuellen Rückforderungsbescheiden zu unterstützen.
Hier finden Sie meine Kontaktdaten: rueckforderungsschutz.de/kontakt