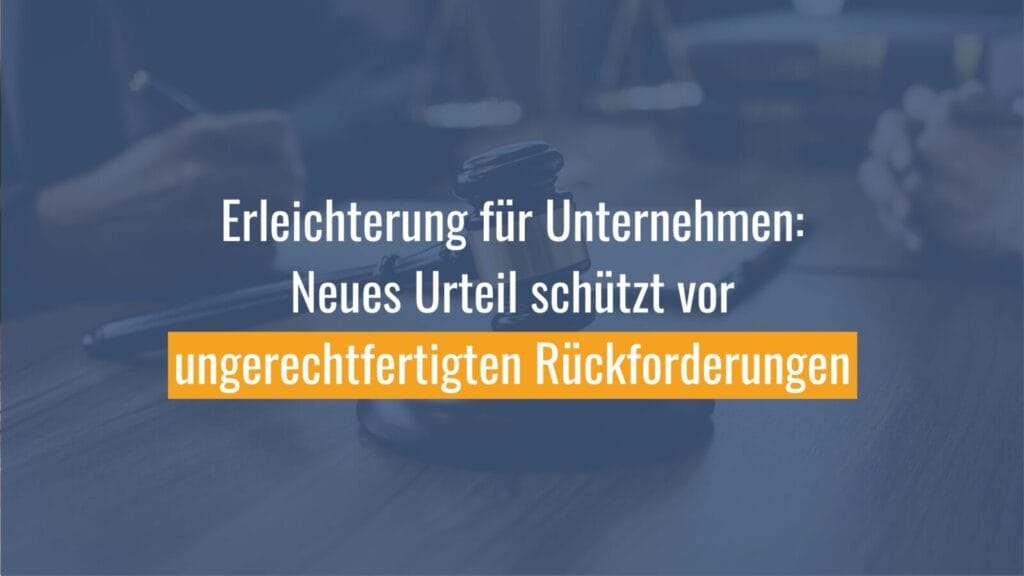Wenn Soforthilfe zur Last wird: Die Problematik der Rückforderungen
Während der Corona-Pandemie standen Unternehmen und Selbstständige vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Um diese zu bewältigen, haben Bund und Länder zahlreiche Soforthilfeprogramme aufgelegt. Die Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden sollten, sollten helfen, die Liquidität der Unternehmen sicherzustellen und Insolvenzen zu vermeiden.
Doch nun sehen sich viele Unternehmer mit Rückforderungen der staatlichen Hilfen konfrontiert. Ein aktuelles Gerichtsurteil schafft jetzt Klarheit darüber, wann und unter welchen Voraussetzungen solche Rückforderungen rechtmäßig sind und wann nicht.
Rückforderungen der Corona-Soforthilfen: Warum Probleme entstehen
In der Hektik der Pandemie wurde der Prozess zur Beantragung der Soforthilfen stark vereinfacht, um den Betroffenen schnelle Unterstützung zukommen zu lassen. Doch in der nachträglichen Überprüfung gingen einige Behörden dazu über, Teile oder die gesamten Hilfsbeträge zurückzufordern.
Ein häufiges Argument: Die Empfänger hätten die Mittel nicht korrekt verwendet, weil die finanzielle Lage im Rückblick – aus Sicht der Behörden – keinen „Liquiditätsengpass“ mehr aufwies. Für die Unternehmen stellt dies eine enorme Belastung dar, da sie sich nun mit nachträglich veränderten oder neu interpretierten Anforderungen konfrontiert sehen.
Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat kürzlich im Fall eines Unternehmens aus Baden-Württemberg entschieden, das die Rückzahlung eines Teils der Corona-Soforthilfe verweigert hatte. In einem umfassenden Urteil wurde dargelegt, wann eine Rückforderung zulässig ist und wann nicht. Diese Entscheidung könnte richtungsweisend für viele betroffene Unternehmen sein.
Das Urteil 18 K 6291/22: Klarheit im Fall eines Unternehmens aus Baden-Württemberg
Das Verwaltungsgericht Stuttgart entschied am 16. September 2024 zugunsten eines Friseursalons, das die Rückzahlung eines Teils der Soforthilfe in Höhe von 10.424,21 EUR verweigert hatte. Die Begründung der Entscheidung ist besonders aufschlussreich und könnte vielen Unternehmen als Orientierung dienen.
Die wichtigsten Punkte des Urteils:
1. Unklare Definitionen in den Bescheiden: Liquiditätsengpass vs. existenzbedrohliche Wirtschaftslage
Die Soforthilfen wurden ursprünglich zur „Überwindung einer existenzbedrohlichen Wirtschaftslage“, eines „Liquiditätsengpasses“ oder eines „Umsatzeinbruchs“ gewährt.
Doch häufig wurden diese Begriffe in Bewilligungsbescheiden, Anträgen und in den FAQ der Behörden uneinheitlich verwendet. In einigen Bescheiden wurden die Begriffe wie „Liquiditätsengpass“ und „Umsatzeinbruch“ sogar gleichwertig nebeneinander genannt, ohne dass für die Empfänger klar war, dass die Förderung nur zur Überbrückung eines akuten Liquiditätsengpasses bestimmt sei. Das Gericht urteilte, dass eine Rückforderung nur mit Blick auf den fehlenden Liquiditätsengpass in diesem Fall unzulässig sei, weil der Zweck der Förderung nicht eindeutig und klar genug kommuniziert wurde.
2. Rückforderung im Rückblick: Betrachtungszeitraum und Zweckbestimmung
Das Gericht stellte ebenfalls fest, dass die Behörden die Förderung nachträglich nicht an Kriterien knüpfen dürfen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht klar waren. Die Behörde hatte im Rückmeldeverfahren darauf bestanden, dass ein Liquiditätsengpass im Zeitraum von drei Monaten nach Antragstellung anhand einer ex-post-Betrachtung der Finanzen nachgewiesen werden müsse.
Die Antragsteller hatten jedoch weder aus dem Antrag noch aus dem Bewilligungsbescheid erkennen können, dass eine solche nachträgliche Bewertung gefordert wird. Für das Unternehmen war bei der Antragstellung nur klar, dass eine eidesstattliche Erklärung über die Verwendung der Mittel ausreichend sei.
Diese nachträgliche Regelung, die erst durch spätere FAQs und nachträglich erlassene Verwaltungsvorschriften festgelegt wurde, verstoße nach Ansicht des Gerichts gegen das Prinzip der Rechtssicherheit. Das Urteil besagt: Es muss im Bewilligungszeitpunkt festgelegt sein, wann und wie der Verwendungszweck überprüft wird, um Missverständnisse zu vermeiden und den Unternehmen Sicherheit zu geben.
3. Keine pauschale Rückforderung möglich – individuelle Prüfung erforderlich
Ein weiteres zentrales Argument des Gerichts war, dass pauschale Rückforderungen ohne Einzelfallprüfung unzulässig sind. Es zeigte sich, dass das Rückmeldeverfahren der Behörde alle Empfänger der Soforthilfe gleich behandelte, unabhängig davon, wann sie ihren Antrag gestellt hatten und unter welchen Bedingungen die Bewilligungen ausgesprochen wurden.
Tatsächlich gab es während der Pandemie jedoch verschiedene Förderprogramme und Richtlinien, die sich teilweise widersprachen oder in Details stark unterschieden. Das Gericht kritisierte die einheitliche Behandlung aller Fälle als rechtswidrig. Eine pauschale Rückforderung könne nicht ohne Weiteres vorgenommen werden, wenn die förderrechtlichen Rahmenbedingungen unklar oder missverständlich kommuniziert wurden.
Rückzahlungen durch ex-post-Betrachtungen: Was für Unternehmen wichtig ist
Das Urteil verdeutlicht, dass eine ex-post-Betrachtung der Liquidität, wie sie die Behörden im Nachhinein durchführen, unrechtmäßig sein kann. Unternehmen, die während der Pandemie von Liquiditätssorgen geplagt waren und die Soforthilfe verwendet haben, um kurzfristige Verbindlichkeiten zu decken, mussten bei Antragstellung lediglich glaubhaft machen, dass sie von einer „existenzbedrohlichen Wirtschaftslage“ betroffen waren.
Die Rückforderung von Zuschüssen aufgrund einer nachträglichen anderen Bewertung verstößt laut Gericht gegen das Transparenzprinzip.
Konsequenzen für Unternehmen: Wie sollten sie nun vorgehen?
Für Unternehmen bedeutet dieses Urteil eine wichtige Absicherung. Wer sich in einer ähnlichen Situation befindet und eine Rückforderung erhalten hat, sollte den ursprünglichen Bewilligungsbescheid, die Antragsunterlagen und die damals geltenden FAQ genau prüfen. Besonders relevant sind dabei folgende Punkte:
Bewilligungsbescheid und Antragsformular:
Wurden im Bescheid oder Antrag klare Hinweise auf die Bedingung eines „Liquiditätsengpasses“ gegeben? Waren alle Verwendungszwecke (z. B. Liquiditätsengpass, Umsatzeinbruch, existenzbedrohliche Lage) gleichermaßen als Förderziel angegeben?
Rückmeldeverfahren:
Falls eine Rückmeldung zum Finanzstatus eingefordert wurde: Waren die Anforderungen klar, und waren sie bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung bekannt?
Nachträgliche Änderungen:
Prüfen Sie, ob Ihre Förderbedingungen nachträglich durch spätere Verwaltungsvorschriften geändert wurden und ob Sie darauf verwiesen wurden.
Wer sich nicht sicher ist, ob die Rückforderung rechtmäßig ist, kann sich auf das aktuelle Urteil berufen und sich anwaltlich beraten lassen, ob die Rückforderung anfechtbar ist.
Lehren für künftige Förderprogramme: Klare Formulierungen und transparente Bedingungen
Dieses Urteil verdeutlicht, wie wichtig es ist, Förderprogramme klar und eindeutig zu gestalten. Besonders in Krisenzeiten, in denen die staatlichen Programme dazu beitragen sollen, Unternehmen schnell und zielgerichtet zu helfen, dürfen Förderbedingungen nicht missverständlich oder interpretierbar formuliert sein. Ein transparenter und verlässlicher Rahmen schafft das Vertrauen, das nötig ist, damit Unternehmen die Unterstützung annehmen und im Vertrauen auf die Hilfszusagen in ihre Zukunft investieren.
Fazit: Ein Hoffnungsschimmer für Unternehmen nach der Corona-Soforthilfe
Das Urteil des Verwaltungsgerichts zeigt eine bedeutende Klarstellung in der rechtlichen Bewertung von Corona-Soforthilfen und der Rückforderungspraxis. Für Unternehmen, die die Soforthilfe nach der ursprünglichen Richtlinie von März 2020 in Anspruch genommen haben, ergibt sich daraus ein ermutigendes Ergebnis: Die Rückforderung der Zuwendungen ist nicht ohne Weiteres rechtens, wenn unklare Zweckbindungen und widersprüchliche Anforderungen an die Mittelverwendung vorliegen.
Unternehmen können darauf hoffen, dass ähnliche Fälle sorgfältig geprüft werden müssen und eine pauschale Rückforderung durch die Behörden in solchen Fällen nicht standhält und rückwirkende Bedingungen ins Gegenteil umschlagen dürfen.
Wenn Sie Unterstützung bei der Prüfung einer Rückforderung Ihrer Soforthilfe benötigen oder Fragen haben kontaktieren Sie mich gerne.
Hier finden Sie meine Kontaktdaten: rueckforderungsschutz.de/kontakt
Hier finden Sie das gesamte Urteil des VG Stuttgart: https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/NJRE001589354